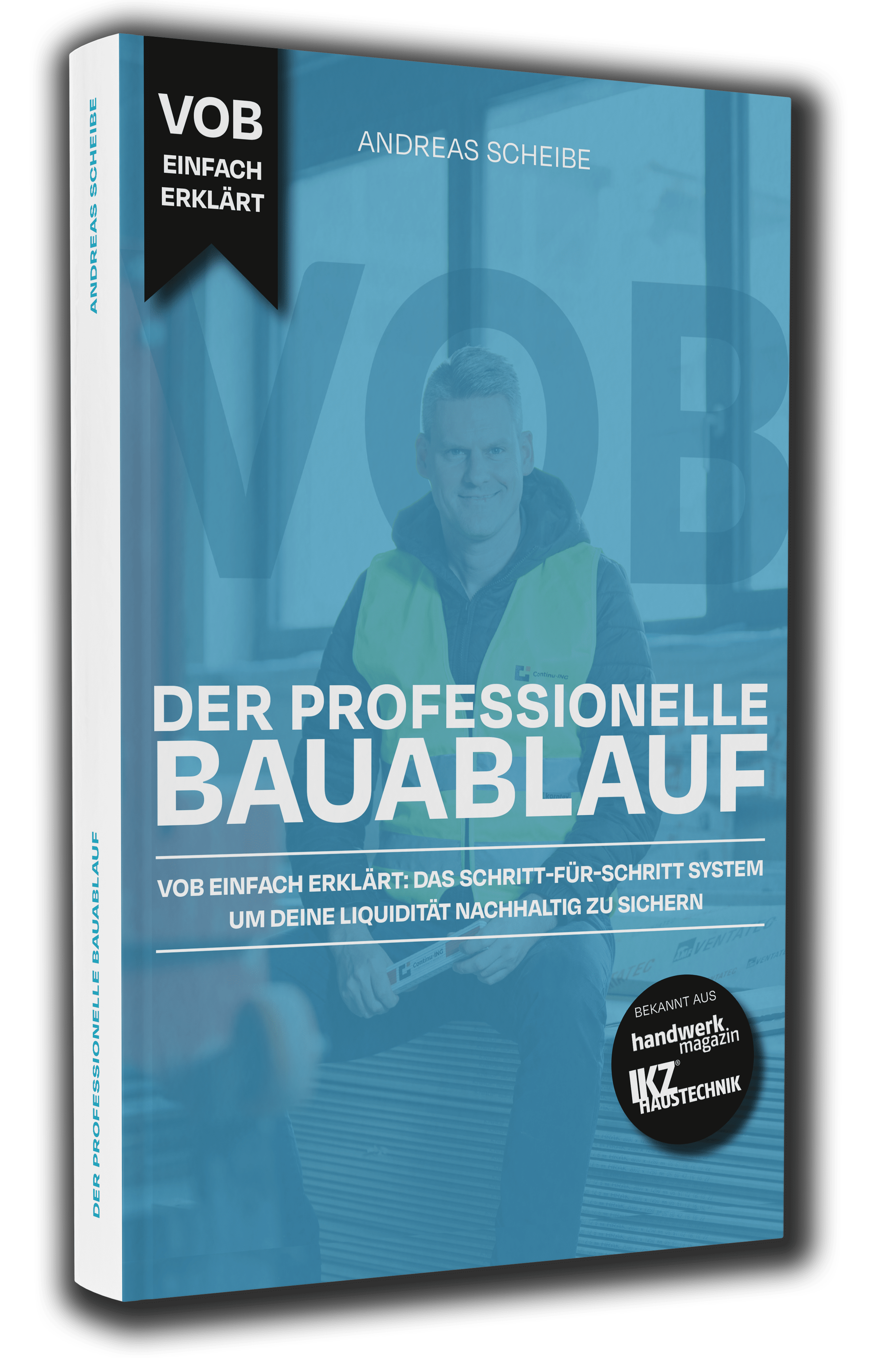Auf dem Papier passt alles: Zeichnungen sauber, Positionen im Leistungsverzeichnis klar nummeriert, Plantermine abgestimmt. In der Ausführung prallen jedoch zwei Welten aufeinander. Planerseite denkt in Funktion, Norm und Gestaltung; der Handwerksbetrieb steuert Kolonnen, Rüstzeiten, Geräteeinsatz, BGK/AGK sowie Wagnis & Gewinn. Die Urkalkulation ist das Betriebssystem dieser Produktionswelt – und genau deshalb für Architekt:innen und Fachplaner:innen oft schwer greifbar. Wer diese Lücke versteht und erklärt, positioniert sich als professioneller Ausführer und arbeitet profitabel.
Planung vs. Produktion: Wo die Sichtweisen kollidieren
Planung optimiert Grundriss, Technik und Normkonformität. Produktion optimiert Takt, Wege, Umsetzzeiten und Herstellkosten. Daraus entstehen typische Reibpunkte:
- Langtexte vs. Leistungstiefe: Allgemeine Beschreibungen verschieben Umsetzungsspielräume in die Ausführung.
- Mengen vs. Ablauf: Planmengen berücksichtigen selten Rüstwechsel, Wartezeiten oder Schnittstellen.
- „Inkl. Nebenleistungen“: Unklare Sammelbegriffe werden zur Blackbox für Zusatzaufwände.
Konsequenz: Ohne dokumentierte Annahmen in der Urkalkulation geht die betriebliche Logik im Vergabeprozess unter. Nachträge lassen sich schwieriger dem Grunde und der Höhe nach belegen.
Warum Architekt:innen mit Urkalkulation wenig anfangen
In der Architekturausbildung dominieren Entwurf, Bauphysik, Design und Leistungsbilder (HOAI). Baubetriebslehre – Taktplanung, Kolonnenmodelle, Rüststrategien, Gerätekosten – kommt kaum vor. Dadurch entsteht ein blinder Fleck:
- Fokus auf Vergleichbarkeit von Angeboten statt auf Herstelllogik.
- Preisfragen ohne Blick auf Zeitansatz, Geräteeinsatz und Logistik.
- Fehlende Übersetzung zwischen Planungsziel und Produktionsrealität.
Ergebnis: Die Urkalkulation wird als „Bieter-Privatsache“ wahrgenommen – nicht als nachvollziehbare Begründung von Produktionskosten.
Jetzt unseren Podcast hören
Warum Fachplaner:innen KLR Bau nicht beherrschen
TGA, Statik, Elektro oder MSR denken vorrangig technisch. Die KLR Bau (Kosten- und Leistungsrechnung im Bau) mit BGK/AGK, Wagnis & Gewinn, Gerätekosten, Stillstandsrisiken und Logistikzuschlägen liegt außerhalb des Kerngeschäfts. Daher bleiben betriebliche Effekte oft unsichtbar:
- Zusätzliche Fahrten, Doppelrüstungen, Taktunterbrechungen werden technisch nicht bewertet.
- Baustellengemeinkosten und Zeitpuffer tauchen im LV kaum auf.
- Abweichungen vom Plan führen zu Mehrkosten, die erst in der Ausführung sichtbar werden.
Ohne klar formulierte Kalkulationsannahmen kann der Handwerksbetrieb diese Effekte später nur schwer belegen.
Was in Ausschreibung und Angebot schiefgeht
Die wiederkehrenden Stolpersteine sind bekannt:
- Vage Langtexte ohne Abgrenzung (enthalten/nicht enthalten).
- Fehlende Ablaufvorgaben: Zugfolgen, Trocknungszeiten, Sperrpausen bleiben offen.
- „Glattgezogene“ Einheitspreise: Vergleichbar, aber realitätsfern.
- Nicht dokumentierte Annahmen: Wissen bleibt im Kopf statt in der Angebotsanlage.
Grundregel: Was nicht schriftlich in den Kalkulationsannahmen steht, existiert in der Auseinandersetzung praktisch nicht.
Die Chance für Handwerkschefs: erklären, positionieren, profitabel arbeiten
Wer die Brücke zwischen Planungs- und Produktionswelt baut, gewinnt Verlässlichkeit und Marge. Drei Hebel wirken sofort:
1) Urkalkulation rahmen – betriebliche Logik sichtbar machen
Kurz und präzise erläutern, wie Preise entstehen:
- Kolonnenstärken, Zeitansätze, Gerätewahl, Wegezeiten.
- Logistikannahmen (Anlieferfenster, Zufahrten, Lagerflächen).
- Rüst- und Umsetzzeiten, Sperrungen, Trocknungs- und Wartezeiten.
- Risiken und Puffer (Witterung, Schnittstellen, Zuständigkeiten).
Damit wird aus „teuer“ eine nachvollziehbare Kostenstruktur.
2) Kalkulationsannahmen als Angebotsanlage verankern
Strukturiert und prüffähig:
- Abgrenzungen je LV-Bereich (enthalten/nicht enthalten).
- Bezug auf Planstände (Version, Datum) und Zeichnungen.
- Messbare Voraussetzungen (Zeitfenster, Kran-/Lift-Nutzung, Zugänglichkeit).
- Dokumentationsroutine: Bautagebuch, Regieberichte, Fotostandpunkte, Mengenfortschreibung.
Die Annahmen schaffen die Beweisführung für Nachträge – dem Grunde und der Höhe nach.
3) Nachträge sachlich führen – aus der Urkalkulation hergeleitet
- Grundlage: Abgleich LV-Text ↔️ Annahme ↔️ tatsächliche Anordnung/Behinderung.
- Höhe: Transparent aus Zeit, Geräten, Material, Zuschlägen (BGK/AGK, W&G) abgeleitet.
- Timing: Anzeige rechtzeitig, Unterlagen vollständig, Argumentation konsistent.
So entsteht Akzeptanz statt Diskussion über „Gefühlspreise“.
Kommunikationsleitfaden für Vergabe- und Startgespräche
Knapp, respektvoll, baubetrieblich klar:
- Zielklärung: „Technische Funktion verstanden – betriebliche Konsequenz ergänzt.“
- Schnittstellenfrage: „Welche Leistungen sind bauseits, welche eigenständig?“
- Ablaufrealität: „Einbau in einem Zug oder in Abschnitten? Sperrpausen vorhanden?“
- Logistikfenster: „Anlieferzeiten, Hebezeug, Wege – wer stellt was, wann, wo?“
- Nachweisführung: „Annahmen liegen bei, Dokumentation ab Tag 1.“
Diese Routine reduziert Missverständnisse und verlagert Diskussionen vom Preis zur Produktionslogik.
Praxisbeispiel (kompakt)
LV-Text: „Abhangdecke herstellen, inkl. Nebenleistungen.“
Urkalkulationsannahmen: Zwei Montagetakte, Materialanlieferung ebenerdig, Hubgerät bauseits, keine Nacht-/Sperrzeiten, Entsorgung Verpackung nicht enthalten.
Bauablauf: Anlieferung nur über engen Lastenaufzug, zusätzliche Umladung, Hubgerät selbst zu stellen, Montage in drei statt zwei Takten.
Ergebnis: Mehrfahrten, Doppelrüstungen, längere Wegezeiten. Mit dokumentierten Annahmen ist der Nachtrag plausibel und prüffähig.
Fazit
Architekt:innen und Fachplaner:innen sind starke Partner für Funktion, Gestaltung und Technik – doch die Urkalkulation bleibt ein Instrument der Ausführung. Fehlende Baubetriebslehre auf Architekturseite und geringe KLR-Bau-Vertrautheit bei Fachplaner:innen erklären, warum betriebliche Logik oft unsichtbar bleibt. Genau darin liegt eine Chance: Wer die Urkalkulation erklärt, Kalkulationsannahmen verankert und Nachweise konsequent führt, positioniert den Handwerksbetrieb als verlässlichen Produktionsprofi – mit stabilen Abläufen, akzeptierten Nachträgen und profitablen Projekten.
FAQ
Warum „verstehen“ Planer die Urkalkulation oft nicht?
Weil sie kein Planungs-, sondern ein Produktionsinstrument ist: Zeitansätze, Geräteeinsatz, Logistik und Zuschläge bilden die Herstelllogik des Ausführenden ab – Inhalte, die in Planung und HOAI nicht vertieft werden.
Wie detailliert sollten Kalkulationsannahmen sein?
Kompakt, aber konkret: klare Abgrenzungen, messbare Voraussetzungen, benannte Schnittstellen. Jede Annahme muss im Verlauf überprüf- und belegbar sein.
Wie wird daraus Profit statt Reibung?
Durch frühe Kommunikation der Annahmen, saubere Angebotsanlagen und konsequente Dokumentation während der Ausführung. So werden Nachträge nachvollziehbar – und Preise akzeptiert.