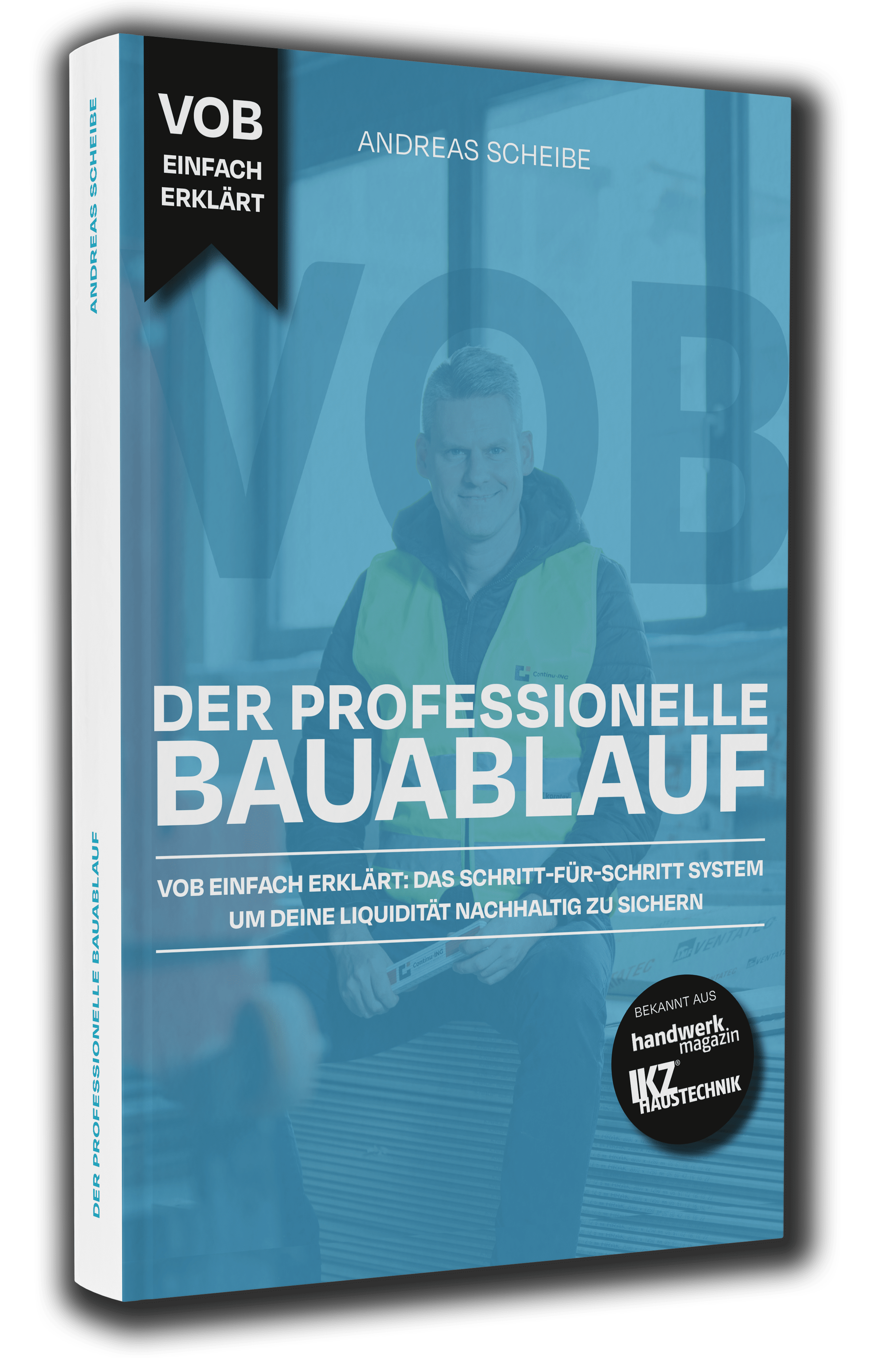Fünf Millionen Euro im Auftragsbuch, Kolonnen bereit, Geräte disponiert – und dann passiert: nichts. Keine Freigabe, keine Vorleistung, kein Material. Statt Fortschritt nur Funkstille, während Löhne, Mieten und Baustellengemeinkosten weiterlaufen. Das ist kein Schicksal, sondern ein Steuerungsproblem. Wer nicht anzeigt, beziffert und abrechnet, finanziert fremde Verzögerungen aus eigener Tasche. Genau hier setzt professionelles Nachtrags- und Behinderungsmanagement nach VOB/B an: Dokumentieren → Anzeigen → Stillstand abrechnen → Forderung stellen. Dass Stillstände sofort auf die Liquidität durchschlagen und Umverteilungen selten reibungslos klappen, ist baupraktische Realität – und gut belegbar.
Reality-Check: Die verbrannte Marge hat Ursachen – und einen Preis
- 4 Monate Bauverzug ≈ 60.000 € Verlust bei mittlerem Betrieb (gebundene Kolonnen, Geräte, BE-Vorhaltung, Wiedereinarbeitung).
- Blockierte Kolonnen ≈ 15.000 €/Monat ohne Gegenleistung – Lohn und Gerätekosten laufen, Leistung fällt aus.
- Bis zu 30 % weniger Deckungsbeitrag jährlich, wenn Bauzeitverzögerungen nicht sauber abgerechnet werden.
Diese Zahlen sind keine Ausnahme, sondern der Normalfall, wenn Stillstände nur „informell“ laufen. Die Mechanik dahinter ist simpel: Kosten laufen, Erlöse pausieren. Wer das nicht systematisch dokumentiert, bezahlt den Stillstand bar – täglich.
Warum „anständig mitmachen“ teuer ist
Viele Betriebe „halten die Stellung“: Personal bleibt verfügbar, Geräte stehen vor, BE bleibt aufgebaut. Parallel versucht die Bauleitung, Leute „irgendwo“ einzusetzen. In der Praxis scheitert diese Umverteilung an Plänen, Material und Kapazitäten anderer Baustellen; stattdessen entstehen Einarbeitungsverluste und Scheinproduktivität („Aufräumen, Umlagern, Warten“). Ergebnis: Produktive Leistung gegen Null, Liquidität im Sinkflug.
Wer in dieser Lage weder Behinderung anzeigt noch Stillstand abrechnet, lädt Auftraggebern die Finanzierung der Verzögerung ab – auf eigene Kosten.
Der Wendepunkt: Vom Ohnmachtmodus in die Anspruchsführung
These: Nicht der Bau ruiniert die Marge – das System tut es: Schweigen statt Anzeigen, Hoffen statt Beziffern, Telefonprotokolle statt Schriftform. Und ja: Auftraggeber kalkulieren mit Passivität. Deshalb braucht es ein hartes, sachliches Vorgehen:
- Behinderungsanzeige: Ursache, Ort/Abschnitt, Zeitpunkt/Dauer, betroffene LV-Positionen, Ressourcenbindung – sofort und schriftlich.
- Mitwirkungsverlangen + Fristsetzung: klare To-dos an den Veranlasser (Vorleistung, Freigabe, Planstand).
- Stillstandsabrechnung vorbereiten: Lohn h, Geräte h/Tagessatz, BE-Vorhaltung, Logistik, Wiedereinarbeitung.
- Nachweise täglich sichern: Regieberichte, Fotos (Zeitstempel/Standpunkt), Gerätestundenzettel, Mailverkehr.
- Forderung stellen: dem Grunde (Kausalität) und der Höhe (Kostenherleitung) nach prüffähig.
Die Kernbotschaft: Anzeigen ohne Abrechnung bringen nichts. Dokumentation und Anspruchsstellung sind die einzige Versicherung gegen Liquiditätsabfluss.
„Wann macht man’s geltend?“ – Das richtige Timing in vier Phasen
Phase 1 – Sofort bei Kenntnis der Behinderung
Noch am selben Tag: Behinderungsanzeige per E-Mail (Projektpostfach), mit Zustellnachweis. Inhalt: Auslöser (fehlende Vorleistung/Plan/Freigabe), Abschnitt, Zeitfenster, betroffene Leistungen, gebundene Kolonnen/Geräte, drohende Folgen. Ziel: Kausalität fixieren und den Informationsvorsprung sichern.
Phase 2 – Laufende Stillstandsabrechnung (täglich)
Tagesweise erfassen: Lohn- und Gerätestunden im Stillstand, BE-Vorhaltungstage, Zusatzfahrten, Doppelrüstungen, Wiederanlaufverluste. Regie-/Stundenzettel anhängen, Fotostandpunkte wiederholen. Damit wird aus „gefühltem Ärger“ prüffähiges Geld.
Phase 3 – Zwischenforderung im Abschlag
Spätestens zum nächsten Abschlag: Teilforderung aus den bis dahin angefallenen Stillstandskosten. Transparente Tabellen (Zeit → Kosten → Zuschläge) beschleunigen Einigung. So bleibt der Cashflow stabil, statt auf den Schlussnachtrag zu hoffen.
Phase 4 – Schlussforderung / Bauzeitnachtrag
Nach Ende der Behinderung (oder bei längeren Sperren: monatlich rollierend) die Gesamtabrechnung inkl. Wiedereinarbeitung, Terminfolgen und Leistungsverschiebungen. Wichtig: keine Blackbox – Herleitung aus Urkalkulation, Zeitansätzen, Geräte- und BGK/AGK-Logik.
Jetzt unseren Podcast hören
Schadensbild sauber beziffern: Die Kostenmatrix
- Lohn: Wartezeit, Kolonnennachlauf, Einarbeitung nach Unterbrechung.
- Geräte: Miete/Abschreibung, Bedienung, Mindestabnahmesätze.
- BE-Vorhaltung: Container, Einzäunung, Anschlüsse, Wege – pro Sperrtag.
- Logistik: Zusatzfahrten, Umladung, Lagerung, erneute Anlieferung.
- Qualität/Termine: Nacht-/Ersatzschichten, Taktverluste, Abschnittswechsel.
- Zuschläge: BGK/AGK, Wagnis & Gewinn – nicht vergessen.
Diese Struktur deckt alle typischen Kostentreiber ab, die bei Startverzug unweigerlich auftreten – genau jene, die in der Praxis gern „unter den Tisch fallen“ und damit die Liquidität ruinieren.
Ein kompaktes Praxisbeispiel
- Auslöser: Genehmigte Planfreigabe bleibt aus; Materialfreigabe stoppt Start.
- Tag 1: Behinderung angezeigt, Abschnitt und LV-Bezug genannt, Kolonne (5 MA) + Bühne gebunden.
- Woche 1–4: Tägliche Regieberichte, Fotos (fixe Standpunkte, Zeitstempel), Gerätestunden, BE-Vorhaltung dokumentiert. Umverteilung nicht möglich (kein Plan, kein Material).
- Abschlag 1: Teilforderung Stillstand Woche 1–2 anerkannt.
- Abschlag 2: Teilforderung Woche 3–4 + Wiedereinarbeitung (1,5 Tage) angesetzt – verhandelt, mehrheitlich anerkannt.
- Ergebnis: Cashflow stabil, Gesamtverlust vermieden; Schlussnachtrag restlich einbringlich.
Genau so verhindert systematische Dokumentation den beschriebenen Liquiditätsabfluss.
Mindset: Vom „Bittsteller“ zum Anspruchsmanager
- Anzeigen = Abrechnen. Eine Behinderung ohne monetäre Wirkung ist eine halbe Sache.
- Täglich, nicht nachträglich. Beweise altern schlecht. Heute dokumentiert, morgen kassiert.
- Sachlich bleiben. Keine Wutprosa – klare Fakten, klare Kosten, klare Fristen.
- Standard statt Heldentaten. Templates, Routine, Zustellnachweise: So entsteht Verlässlichkeit.
Wer das durchzieht, schreibt keine höflichen Briefe, sondern abrechenbare Vorgänge. Anwälte leben von Lücken – schließe sie mit Dokumentation und Anspruchsführung.
Zusammenfassung
Vier Monate Leerlauf sind kein Naturgesetz. Sie sind das Ergebnis fehlender Schriftform, unvollständiger Nachweise und ausbleibender Forderungen. Ab heute: anzeigen, beziffern, abrechnen – und den Cashflow schützen. Wer System sucht statt Zufall: Prozesse, Vorlagen und Leitfäden gibt’s bei voberklaert.de – damit Bauzeitverzug nicht länger dein Konto leert, sondern vergütet wird.
FAQ
Reicht eine Behinderungsanzeige per Telefon?
Nein. Telefonate helfen in der Abstimmung, begründen aber keine prüffähigen Ansprüche. Es braucht schriftliche Anzeigen mit Kausalität, Dauer und Ressourcenbindung plus Nachweise (Regie, Fotos, Gerätestunden). Nur das lässt sich im Abschlag abrechnen.
Was tun, wenn die Bauleitung meinen Bericht nicht unterschreibt?
Kein Drama – Zustellnachweis sichern: Tagesbericht per E-Mail an Projektadressen, Upload ins CDE mit Protokoll-ID. Kurz vermerken: „Unterschrift vor Ort nicht erteilt.“ Belege (Fotos, Stundenzettel) beifügen und weiter täglich dokumentieren.
Kann man während der Sperre Personal einfach umverteilen?
In der Theorie ja – in der Praxis scheitert es oft an Plänen, Material, Kapazitäten. Dann entstehen Einarbeitungsverluste und Scheinproduktivität. Das frisst Liquidität. Besser: sauber anzeigen, Stillstand abrechnen und nur wirtschaftlich sinnvolle Umsetzungen vornehmen.
Welche Kostenarten werden bei Bauzeitverzug häufig vergessen?
Neben Lohn und Geräten vor allem BE-Vorhaltung, Logistik (Zusatzfahrten/Umladungen), Wiederanlaufverluste (Doppelrüstungen/Einarbeitung) sowie BGK/AGK und Wagnis & Gewinn. Diese Posten machen den Unterschied zwischen „nett angezeigt“ und tatsächlich bezahlt.