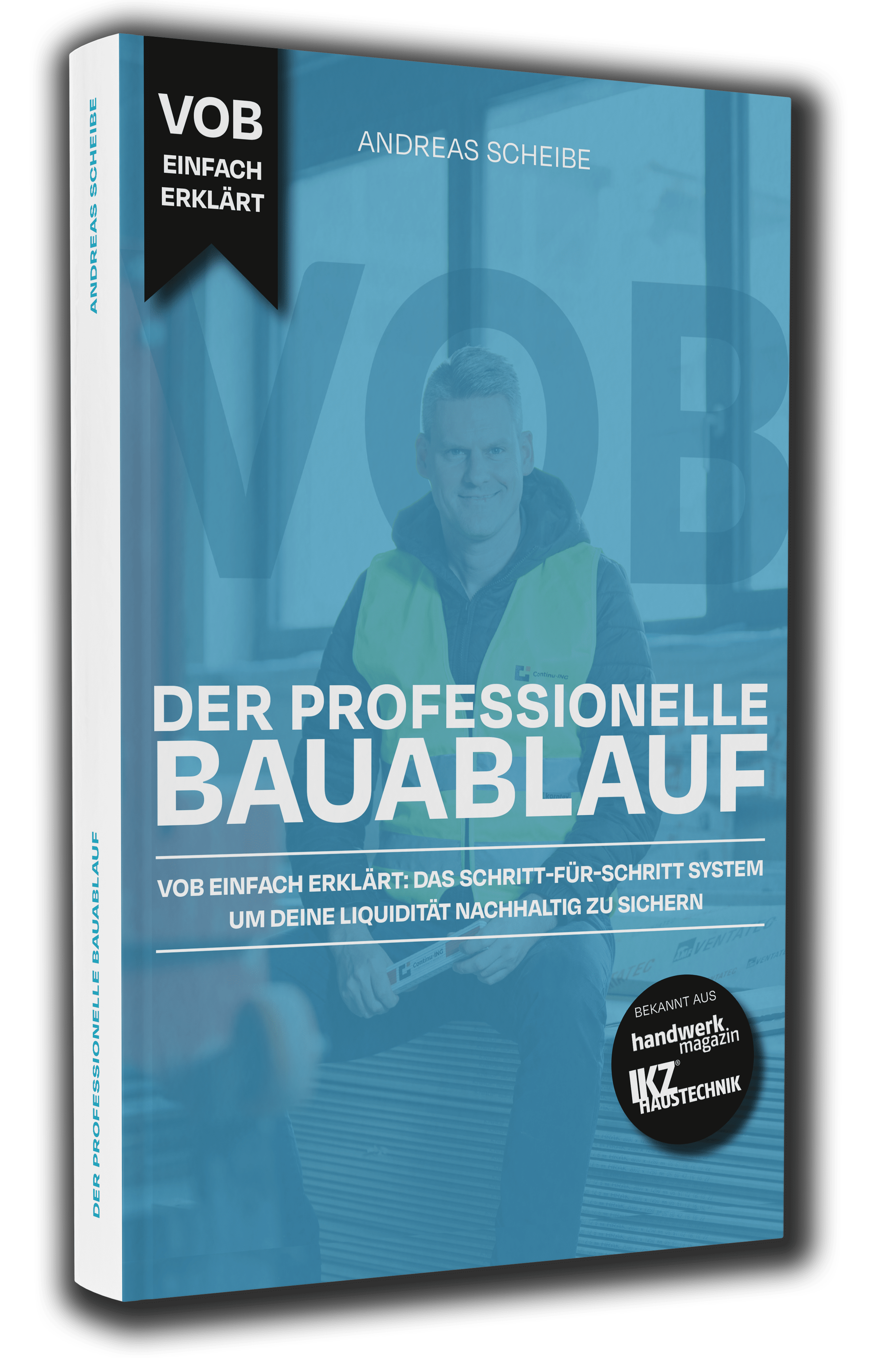Wer Auftraggebern Arbeit abnimmt, verliert oft Geld: Eine klare Anwendung der VOB schützt nicht nur Fachfirmen, sondern verbessert auch den Projekterfolg spürbar.
Missverständnisse auf der Baustelle: Wo die VOB zur Grauzone wird
Zunehmend beginnt die Ausführungsphase mit unvollständigen oder widersprüchlichen Planungsunterlagen – eine Entwicklung, die erfahrene Baupraktiker, wie ein Geschäftsführer eines großen Gebäudetechnikunternehmens aus Mainz, klar beobachten. Zwischen Entwurfsfragmenten, unvollständigen Leistungsverzeichnissen und spontanen Anpassungen auf der Baustelle eskalieren Planungslücken regelmäßig.
Die Folge: Zeitverzug, Frust auf der Baustelle und zunehmende wirtschaftliche Risiken.
Die größten Herausforderungen bei der Praxisumsetzung der VOB
Die Verdichtung der Bautätigkeit, steigende Anforderungen an technische Gebäudeausrüstung und die Komplexität der Planungsprozesse belasten Bauunternehmen zunehmend. Drei Hauptprobleme wiederholen sich im Umgang mit der VOB fast regelmäßig:
- Unvollständige Planung: Ausführungspläne fehlen oder widersprechen dem Leistungsverzeichnis
- Schlechte Kommunikation zwischen den Beteiligten: Abstimmungen mit Planern und Auftraggebern verlaufen schleppend
- Verlagerung der Planung auf die Ausführenden: Unternehmen übernehmen Aufgaben, die nicht zu ihrem vertraglichen Umfang gehören
All das führt zu einer spiralförmigen Überlastung: Obermonteure und Projektleitungen sollen improvisieren – ohne Rückhalt durch vollständige Grundlagen. VOB-konform arbeiten? Kaum möglich, wenn Plan oder Leistungsverzeichnis nicht synchron laufen. Doch die VOB bietet klare Spielregeln – wenn man sie durchsetzt.
Der Weg aus dem Chaos: VOB richtig einsetzen
Statt nur zu reagieren, setzen erfolgreiche Unternehmen heute auf VOB-gerechtes Agieren. Der Schlüssel: Frühzeitige Kommunikation, rechtssichere Anzeigen und konsequente Ablehnung nicht vereinbarter Mehrleistungen. Die Umsetzung folgt dabei einem klaren Prozess, der auch bei gestörten Bauabläufen tragfähig bleibt:
1. Montageplanung vor Baubeginn einfordern
- Keine Baustelle ohne freigegebene Ausführungsunterlagen
- Prüfung von Plan- und Leistungsverzeichnis auf Konsistenz
- Dokumentation von Lücken und Widersprüchen vor der Ausführung
2. Bedarfsanzeigen und Behinderungsanzeigen rechtzeitig übermitteln
- Frühzeitige schriftliche Mitteilung bei Unklarheiten oder Behinderungen
- Anwendung standardisierter Vorlagen für Behinderungsanzeigen nach § 6 VOB/B
- Konsequente Nachverfolgung mit Fristen und Dokumentation
3. Rückendeckung durch Geschäftsführung und strukturierte Kommunikation
- Konfliktträchtige Themen dürfen nicht allein auf den Projektleiter abgewälzt werden
- Geschäftsleitung unterstützt aktiv bei Verhandlungen mit Auftraggebern
- Regelmäßige interne Schulungen zu VOB, Nachträgen und Schriftverkehr
4. Annahmeverzug systematisch dokumentieren
Der Annahmeverzug nach § 6 VOB/B ist kein theoretisches Konstrukt. Sobald der Auftraggeber Leistungen nicht wie geplant abnehmen oder zulassen kann, zählt jedes Dokument:
- Sofortige Anzeige des Verzugs
- Aufstellung der daraus entstehenden Mehrkosten (z. B. Lohn, Gerät, Stillstand)
- Gesprächsangebote als gestuftes Eskalationsmodell vor recoursrechtlichen Maßnahmen
Jetzt unseren Podcast hören
Konsequenz statt Kulanz: Warum der Helferinstinkt teuer wird
Über Jahrzehnte hinweg agierten viele Handwerks- und Bauunternehmen als stille Korrekturinstanz fehlerhafter Planung. Sie baute um, ergänzten, und zeichneten neu – oft ohne Anspruch auf zusätzliche Vergütung.
Das Fazit dieser kollektiven Nachsicht: Wenig Wertschätzung durch Auftraggeber, wirtschaftliche Einbußen und personelle Belastungen bis hin zur Kündigung gestresster Projektverantwortlicher.
Erst ein deutlicher Rollenwechsel – vom ausführenden Helfer zum begleitenden Partner innerhalb der VOB-konformen Zusammenarbeit – brachte den Wendepunkt: bessere Ergebnisse, zufriedenere Mitarbeiter, wirtschaftlicher Erfolg.
Finanzielle Effekte klar messbar
Ein mittelständisches Gebäudetechnikunternehmen aus Mainz konnte durch strukturierte Umsetzung der VOB-Regeln seine Betriebsergebnisse verdoppeln – insbesondere durch systematisches Nachtragsmanagement und effektive Handhabung von Bauzeitverzögerungen:
- Zusätzliche Erlöse durch Behinderungsanzeigen: rd. 800.000 bis 1 Mio. € jährlich
- Gesteigerte Produktivität: durch Vermeidung von planungsbedingtem Mehraufwand
- Stabilere Teams: geringere Fluktuation, weil Mitarbeiter das Unternehmen als Schutzraum erleben
Transparenz gegenüber Auftraggebern steht dabei im Zentrum: Statt Eskalation suchen VOB-sichere Betriebe strukturierte Abstimmungsgespräche auf Augenhöhe – teilweise mit Erfolg. Denn viele Auftraggeber sind Laien im Bauprozess und erkennen erst durch klare Gegenüberstellungen die Versäumnisse ihrer Planer. Wer also VOB-Forderungen gut kommuniziert, wird nicht nur vergütet, sondern auch für neue Projekte eingeladen.
Strategische Kompetenz in der Projektleitung aufbauen
Ein häufig unterschätztes Defizit im Bauhandwerk: Projektleiter, Techniker oder Meister sind zwar fähige Fachleute, aber betriebswirtschaftlich oft nicht geschult. Die VOB wird selten intensiv gelehrt, und junge Führungskräfte stehen Anforderungen wie § 2, § 6 oder § 13 VOB/B oft hilflos gegenüber.
Eine nachhaltige Strategie umfasst daher:
- Schulung des bestehenden Führungspersonals in VOB-Fragen
- Einstieg über begleitende Online-Trainings und Videomodule
- Klar definierte Richtlinien im Unternehmen (z. B. „Keine Ausführung ohne Planfreigabe“).
Nicht Technik, sondern wirtschaftliches Handeln sichert den unternehmerischen Erfolg – die VOB ist das juristische Fundament dafür.
Fazit: VOB schnell gelernt, nachhaltig gewirkt
Die konsequente Anwendung der VOB sichert nicht nur Erträge, sondern bringt Struktur und Klarheit auf der Baustelle. Unternehmen, die rechtzeitig Hindernisse erkennen, dokumentieren und VOB-konforme Ansprüche erheben, erleben:
- Höhere Erlöse
- Effizientere Bauabläufe
- Bessere Mitarbeiterbindung
- Mehr Anerkennung bei Auftraggebern
Es ist Zeit, die VOB nicht als Verwaltungsaufwand, sondern als wirtschaftliches Instrument zu verstehen. Nicht zuletzt sichern Betriebe auf diese Weise ihren Fortbestand – auch in turbulenten Zeiten.
FAQ – VOB im Baualltag – die häufigsten Fragen
Was ist der häufigste Fehler bei der Anwendung der VOB in der Praxis?
Das Ausführen von Arbeiten, obwohl Planungsunterlagen fehlen oder unvollständig sind – ohne schriftliche Fixierung der Mängel oder Nachträge.
Wann liegt Annahmeverzug vor?
Wenn der Auftraggeber vereinbarte Leistungen nicht zum vorgesehenen Termin zulässt oder vorbereitende Maßnahmen fehlen, die eine Ausführung unmöglich machen.
Was bringt eine professionelle Behinderungsanzeige wirklich?
Eine formal korrekte und rechtzeitige Anzeige kann zu erheblichen Mehrvergütungsansprüchen führen und schützt vor pauschaler Verantwortung bei Terminüberschreitungen.
Wie unterstützt fortlaufende Schulung im VOB-Bereich den Unternehmenserfolg?
Sie stärkt das Rückgrat der Projektleiter, ermöglicht selbstbewusstes Handeln gegenüber Auftraggebern und reduziert kostenintensive Fehler in Bauprozessen nachhaltig.